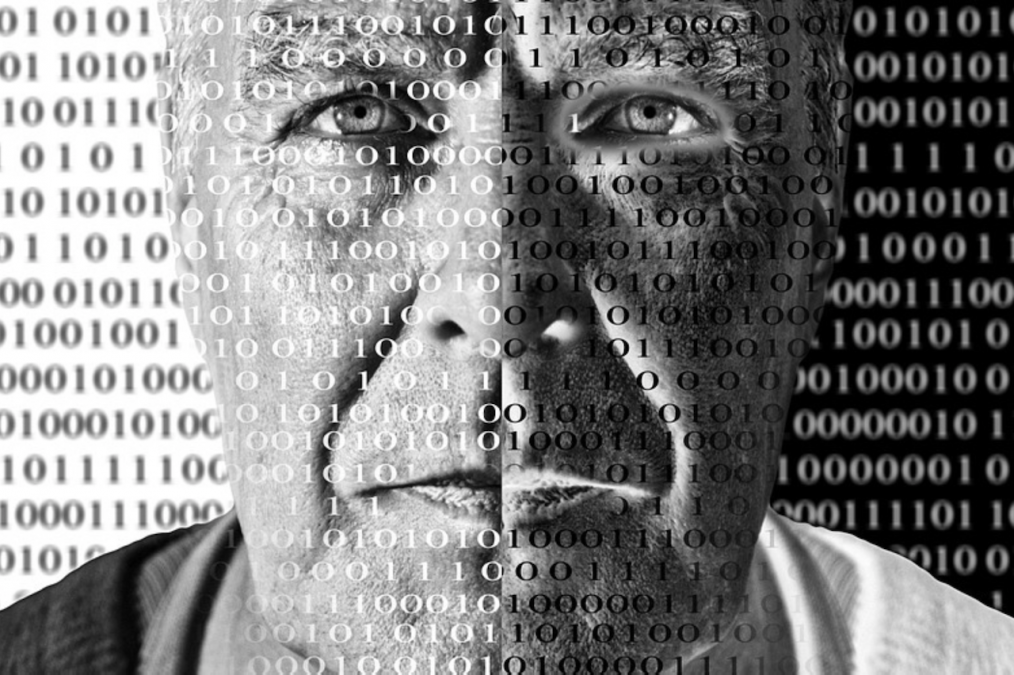Vor vier Jahren, als Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, und alle Welt entsetzt auf dieses Wahlergebnis gestarrt hat, habe ich in einem kurzen Essay den Versuch gewagt, die Gründe dafür zu analysieren. Im Kern ging es mir damals darum zu zeigen, dass ein Großteil der Amerikaner mit den Entwicklungen in ihrem Land nicht zufrieden ist, dass das Modernisierungsprogramm, das die USA unter Barack Obama durchlaufen haben, für eine Vielzahl der Menschen zu progressiv – zu „modern“ – war, wobei ich glaube, dass der „Staat“ hier auch für Entwicklungen abgestraft wurde, die ursächlich gar nicht vom Staat, sondern von der Wirtschaft und ihrer Agenda der Vierten Industriellen Revolution vorangetragen worden sind – oder schlicht und ergreifend von den Erfordernissen einer Anpassung an eine sich im globalen Maßstab verändernde Welt.
Die Digitalisierung macht vor kaum einem Lebensbereich halt. Auch nicht vor dem höchsten Gut aller Menschen, ihrer Gesundheit. Dabei werden die gesundheitlichen Einflüsse der Digitalisierung durchaus vielschichtig und differenziert wahrgenommen und bewertet.
Ökologie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind in aller Munde. Auch steigt die Bereitschaft der Menschen, sich bei diesen Themen zu engagieren. Für Unternehmen ist es daher höchste Zeit, diese Themen aufzugreifen und sich darüber auch als Marken zu profilieren. Die „Bremer Stadtreinigung“ (DBS) bat in einem Pitch um entsprechende Ideen, die in einem Marketingplan über zwei Jahre skizziert werden sollten.
Wenn in Deutschland über Zukunft, Fortschritt oder Technologie gesprochen wird, dann immer nur mit warnend erhobenem Zeigefinger… Alles Neue ist grundsätzlich gefährlich, steckt voller unkalkulierbarer Risiken, lädt zu permanentem Missbrauch ein und will dem deutschen Bürger auch nur Böses…
Progressiv denkende Menschen wie ich können diese Negativsicht der Welt nur schwer nachvollziehen. Man muss ja nicht gleich in naiven Optimismus verfallen, aber ich finde es hilfreich, den Blick nicht immer nur auf die Risiken zu richten, sondern auch mal auf die Chancen, nicht immer nur auf den möglichen Schaden, sondern auch mal auf den potenziellen Nutzen.
Bei meiner Arbeit ist es mir wichtig, Menschen, Institutionen und Unternehmen in ihrem Denken und Handeln dahingehend zu lenken, dass sie die Chancen, die das Digitale bietet, so nutzen, dass daraus Segen und Wohlstand für alle – und nicht nur für eine Minderheit – entsteht.
Digital-ethische Fragestellungen sind für viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter noch „Neuland“. Sich ihrer bewusst zu sein und entsprechenden Handlungsbedarf zu erkennen, ist daher nicht einfach. Zudem klingeln beim einen die „Alarmglocken“ früher, bei anderen später oder gar nicht…
Zahlreiche Diskussionen rund um Datenschutz, Datensicherheit und Datensouveränität – und nicht zuletzt die Gesetzesvorgaben durch die DSGVO – haben vielen Menschen inzwischen klar gemacht, dass es hier etwas zu schützen gibt. Entsprechend ist auch die Sensibilität auf diesem Gebiet gestiegen. Für andere Fragestellungen gilt dies (noch) nicht.
Apple Siri, Google Now, Microsoft Cortana – nahezu jeder hat heute bereits einen sprachbasierten Digitalen Assistenten auf seinem Smartphone. Eine feine Sache, kann man doch beinahe freihändig SMS und Mails verschicken lassen, nach Restaurants in der Nähe suchen lassen, das Wetter überall auf der Welt anzeigen lassen und bald eben auch: Shoppen lassen! Während das Machen-„lassen“ dem Nutzer viele Vorteile bietet, kommen auf den Marketer wieder einmal neue Herausforderungen zu. Eine davon ist etwa die Frage: Wie generieren Digitale Assistenten eigentlich ihre Empfehlungen und wie lässt sich dieser Prozess marketingseitig beeinflussen? Keine einfache Frage!
Schauen wir doch deshalb erst einmal, was Digitale Assistenten (oder auch: Bots, Smart Agents, Mobile Assistants, Virtual Personal Assistants, Conversational Apps etc. – eine verbindliche Bezeichnung hat sich noch nicht etabliert) sind und was sie alles können.
Ein „Rechtsruck“ geht derzeit um die Welt. Meiner Ansicht nach stehen dahinter aber nicht primär nationalistische Tendenzen, sondern vielmehr die Frage: Wie modern kann und will eine Gesellschaft sein. Insofern handelt es sich also weniger um einen Kampf zwischen Linken und Rechten, sondern vielmehr um einen Kampf zwischen Traditionalisten und Modernisten.
Ich bin in den letzten Tagen zufällig mal wieder auf die Jobs-to-be-done-Theorie gestoßen. Der Grundgedanke: Menschen kaufen eigentlich nicht die Produkte oder Dienstleistungen „an sich“; vielmehr „stellen sie sie an“, wie Clayton Christensen in The Innovator’s Solution schreibt, um einen bestimmten Job zu erledigen. Oder anders ausgedrückt: „Kunden wollen keinen Bohrer, sondern ein Loch in der Wand“ (Theodore Levitt).
Klingt erstmal logisch. Und macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn es um die Entwicklung neuer Lösungen für neue oder veränderte Herausforderungen geht. Allerdings erklärt die Theorie nicht, warum ich mich bei mehr oder weniger identischen Produkten für das eine und nicht für das andere Angebot entscheide. Schauen wir uns das mal genauer an!
Als Marketing-Spezialist ärgert man sich gerne über Unternehmen, die ihr Marketing an das Ende ihrer Wertschöpfungskette stellen: Wenn das Produkt entwickelt ist, soll das Marketing zusehen, wie es das Zeugs an den Mann bringt. Dabei sollte mittlerweile doch eigentlich klar sein, dass Marketing eine Disziplin ist, die den gesamten Produktentwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsprozess begleiten sollte.
In der Produktentwicklungsphase kann das Marketing wichtige Consumer Insights beisteuern und Hinweise auf relevante Trends geben, um damit das Design neuer Produkte, Services oder Ökosysteme zu optimieren. Insbesondere der letzte Punkt, das Design von komplexen Ökosystemen, die den Kunden über perfekt synchronisierte Touchpoints, Datenströme und Serviceketten möglichst auf ewig an eine Marke binden, ist ohne das Know-how der Marketingabteilung kaum umzusetzen. Denn hier sollte im Zuge der anhaltenden Digitalisierung der Werbe- und Vertriebskanäle bereits eine solide Basis für eine nachhaltige Transformation des gesamten Unternehmens in Richtung Digitalität entstanden sein. Schließlich funktioniert Marketing heute fundamental anders als noch vor wenigen Jahren.
Egal ob „Branded Behavior“, „Behavioral Branding“, „Internal Branding“ oder „markenorientiertes Mitarbeiterverhalten“ – alle Bezeichnungen stehen für die Entwicklung und den Einsatz der Mitarbeiter für den Erfolg der Marke. Denn die Erfahrung zeigt, dass eine erfolgreiche Markendifferenzierung nicht ohne die wichtigste Ressource eines Unternehmens – seine Mitarbeiter – funktioniert.
„Die Empfangsdame, der Monteur oder der Verkäufer sind für das Image entscheidender als die Worte des Vorstandsvorsitzenden oder der Unternehmenskommunikation.“
Dieses Zitat von Emilio Galli-Zugaro, Leiter der Unternehmenskommunikation der Allianz Gruppe, unterstreicht die Bedeutung von markenorientiertem Mitarbeiterverhalten für die Markenwahrnehmung eines Unternehmens. Leslie De Chernatony, Professor des Brand Marketings an der Università della Svizzera italiana drückt dies in seiner vielzitierten Aussage ähnlich aus: „Brands start their lives through the work of employees”.